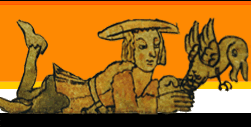

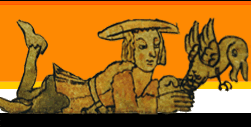 |
 |
Weihestufen Geistlicher im Mittelalter
Zwar konnten nur Männer, nicht Frauen, der Schicht des Klerus angehören, dochgenossen auch andere, die mit der Institution der Kirche verbunden waren, wie etwa Klosterangehörige, die gleiche Unantastbarkeit und die gleichen Vorteile wie Geistliche. Im Mittelalter gab es sieben Weihestufen für allgemeine Geistliche, vier niedrige Weihen und drei höhere. Noch vor diesen gab es die Weihe der Tonsur, bei der den Lehrlingen die Tonsur rasiert wurde. Beschreibungen dieser Weihewurden zum Beispiel in zwei isländischen Handschriften aus dem 14. und 15. Jahrhundert überliefert. Die ersten vier Weihestufen bedeuteten keine lebenslange Verpflichtung gegenüber der Kirche, aber diejenigen, die die drei höheren Weihen entgegennahmen, verpflichteten sich damit der Kirche. Männer, die die niederen Weihen entgegen genommen hatten, konnten so das Bildungsangebot nutzen, ohne danach für den Rest ihres Lebens in der Kirche bleiben zu müssen. Die höheren Priester waren Bischöfe, Erzbischöfe und schließlich der Papst, zumindest im westlichen Christentum. Mönche und Nonnen wurden ebenfallsmit einer formellen Zeremonie oder einer Art Weihe in ihren Klosterorden aufgenommen.In den Handschriften Holm. perg. nr. 5 fol. (1350-1365) und AM 238 XXIII fol. (1400-1500) finden sich Beschreibungen über die Reihenfolge der Weihestufen (oder Weiheschritte) Geistlicher, die vermutlich ähnlich strukturiert waren wie in anderen europäischen Ländern:
- (H)ostiarius ('Türhüter'/Küster): Er beaufsichtigte die Tür (der Kirche oder des Klosters) und die Kirchenornamente und leutete zum Gottesdienst. Sein Weihesymbol ist der Schlüssel.
- Lector ('Vorleser'): Er las Texte zu den Messen (z. B. Morgengottesdienst und Totenmesse). Sein Weihesymbol ist ein Lesebuch.
- Exorcista ('Beschwörer'): Er segnete geistig Verwirrte oder Kranke und diejenigen, die ihre Primsegnung erhielten. Sein Weihesymbol ist das Buch mit den Beschwörungsformeln.
- Acolythus ('Altardiener'): Er war für die Beleuchtung der Kirche verantwortlich, trug Kerzen zum Lesen des Evangeliums und bereitete Wasser und Wein für die Gottesdienste. Seine Weihesymbole sind Kerzen und Wasserkrug.
- Subdiaconus ('Subdiakon'): Er sang ohne Begleitung während der Messe, war aber auch für deren Vorbereitung verantwortlich und assistierte dem Diakon, hielt Lesungen und brachte gemeinsam mit dem Diakon Kelch, Patene und Obladen zum Altar. Seine Weihesymbole sind Kelch, Patene und Kelchlöffel.
- Diaconus ('Diakon'): Auch er assistierte bei der Messe, las aus dem Evangelium und bereitete den Altar für die Verteilung von Brot und Wein (den Leib Christi oder corpus domini). Er unterstützte den Priester, wenn viele das Abendmahl entgegen nahmen, und taufte Kinder, sang die Totenklage und verteilte den corpus domini in der Abwesenheit des Priesters. Der Diakon lehrte auch die Gebete der Priester oder Bischöfe.Seine Weihesymbole sind Evangelium und Stola.
- Presbyterus ('Priester'): Er kümmerte sich um alle kirchlichen Dienste der Gemeinde, sang Messen, weihte Salz und Wasser am Tage des Herren (Sonntag), sowie das Kreuz, den Weihrauch und alle verschiedenen Lebensmittel (wie Brot und Wein für das Abendmahl). Der Priester musste Ehen schließen, die Beichte abnehmen, er musste den Ablauf der Messe kennenund Latein beherrschen, 'so dass er weiß, ob er im Maskulinum oder im Femininum spricht' (so in Holm 5, 'Mann oder Frau' in AM 238 XXIII fol). Desweiteren musste er die Evangelien beherschen, derPredigtenGregors des Großen und des Kirchenkalenders. Der Priester hatte auch Testamente zu vollstrecken, Taufen und Salbungen (wie etwa die letzte Ölung) vorzunehmen, oder Bestattungen und Messgesänge abzuhalten. In Holm 5 heißt es: „Presbyter bedeutet ‚Ältester‘ in unserer Sprache, denn so soll er an Verstand und Wissen sein.“ (in Am 238 XXIII fol: „Priester bedeutet ‚Greis‘ in unserer Sprache, denn so soll er sein an Verstand und Weisheit.“). Bei der Weihe bekamen die Priester ihr Messgewand und 'alle Utensilien, die zum Messegesang gehören' (Ornat).
Quellen: Hjalti Hugason. 2000. Kristni á Íslandi I. Frumkristni og Rómarkirkja. Siehe S. 220.
Messuskýringar I. Liturgisk symbolik frá den norsk-islandske kyrkja i millomalderen. 1952. Herausgegeben von Oluf Kolsrud für Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Osló, Jakob Dybwad. weitere Quelle auf S. 108-110 aus AM 238 XXIII fol. (1400-1500) und Holm. perg. nr. 5 fol. (1350-1365).