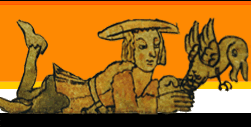

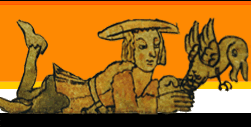 |
 |
Die Arbeitsweise bei alten Übersetzungen
Übersetzungen wurden im Mittelalter besonders auf drei Arten ausgeführt:
- wörtliche Übersetzungen, z.B. Bibelübertragungen im Urchristentum.
- Vorlagengetreue Übersetzungen, der Normalfall, der aber wörtliche Übersetzungen nicht ausschloss.
- freie Übersetzungen, die häufig aus mehreren Vorlagen kompiliert wurden und fast schon als eigenständige Originalwerke angesehen werden können.
Die Arbeit des Übersetzers bestand darin, den Inhalt unverfälscht in eine andere Sprache zu übertragen und außerdem jedes Mal Rücksicht auf den Empfänger zu nehmen. Manchmal wurden abstrakte Begriffe oder sogar ganze Kapitel aus einer Schrift weggelassen oder nacherzählt.
Drei gelehrte Schriften aus dem 12. und 13. Jahrhundert können als Beispiel für diese unterschiedlichen Arbeitsmethoden angeführt werden: Um kostu og löstu (De virtutibus et vitiis, Über die Tugenden und die Laster) von Alkuin von Tours ist eine fast wörtliche Übersetzung eines lateinischen Textes. Bei der Übersetzung des Elucidarius von Honorius Augustodunensis wurde der mittlere Weg gewählt, und Um festarfé sálarinnar (Soliloquium de arrha animae, Monolog über das Pfand der Seele) von Hugo von St. Viktor ist stellenweise stark bearbeitet.
Vgl. Gunnar Harðarson. 1989. Þrjár þýðingar lærðar frá miðöldum.
Der Erste Grammatische Traktat im Codex Wormianus
Der Erste Grammatische Traktat ist nur in einer Handschrift aus der Mitte des 14. Jahrhunderts überliefert, in der Ormsbók (Codex Wormianus) AM 242 fol., die sich heute in der Arnamagæanske Samling, der Handschriftenabteilung des Nordischen Instituts in Kopenhagen, befindet. In der Handschrift sind neben einer Einleitung die vier isländischen mittelalterlichen grammatischen Traktate überliefert, in chronologischer Reihenfolge, aber nicht durch Titel oder Überschriften voneinander getrennt. Die spätere Forschung hat die Abhandlungen unterteilt und bezeichnet sie nach ihrer Reihenfolge in der Handschrift als Erster, Zweiter, Dritter und Vierter Grammatischer Traktat.Der Codex Wormianus ist zugleich eine der Haupthandschriften der Snorra-Edda und beinhaltet außerdem die einzige überlieferte Version des Gedichtes Rígsþula, das zu den Eddagedichten zählt. Es berichtet von Heimdall, der unter dem Decknamen Ríg die Welt der Menschen aufsucht, jeweils eine Nacht bei drei Ehepaaren übernachtet und so die drei Stände begründet: den Stand der Sklaven, den der Kleinbauern und Arbeiter und schließlich den Stand der Großbauern und Fürsten.
Die Handschrift ist nach dem dänischen Arzt und Archäologen Ole Worm benannt, der sie im Jahre 1628 erwarb. Árni Magnússon kaufte die Ormsbók 1706 vom dänischen Bischof Christian Worm, Oles Enkel. Seitdem ist sie Bestandteil seiner Sammlung. Wie die Handschrift entstand und wem sie gehörte, bis der Gelehrte Arngrím Jónsson sie für Ole Worm, wahrscheinlich von seinem Verwandten, dem Bischof Guðbrand Þorláksson, erwarb, ist weitgehend unbekannt, jedoch befinden sich seine Initialen auf einer Seite. Man weiß nicht, woher Guðbrand das Buch bekam, aber möglicherweise hatte er es von seinem Großvater mütterlicherseits geerbt. Jón Sigmundsson war Oberster Richter (lögmaður) in Víðdalstunga und stammte aus einer wohlhabenden Familie, die sich ausgiebig mit dem Studium von Büchern beschäftigte.