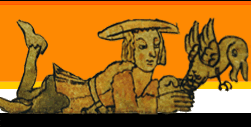

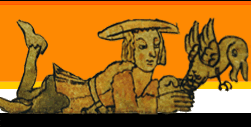 |
 |
Wissensbissen zur Rechtscheibung von Halldór Laxness
Lange bestand eine ausgesprochene Abneigung gegenüber den Rechtschreibgewohnheiten von Halldór Laxness. Seinen ersten Roman Barn náttúrunnar („Ein Kind der Natur”) brachte er im Jahre 1919 heraus, ein Jahr, nachdem das Regelwerk zur Orthographie eingeführt worden und die Diskussion über eine normierte Rechtscheibung einige Zeit im Gange gewesen war. Uneinigkeit bestand vor allem darüber, ob die Etymologie oder die Aussprache die Schreibung bestimmen sollten. Die offizielle Orthographie wurde schließlich viel von etymologischen Gesichtspunkten bestimmt, die Rechtschreibung von Halldór Laxness aber wich sein ganzes Leben als Schriftsteller von ihr ab, obwohl sie anfangs beständig weiterentwickelt zu werden schien.Eine von den Regeln der offiziellen Orthographie, die von etymologischen Überlegungen bestimmt wird, ist, dass vor ng und nk ein kurzer Vokal ohne Akzent geschrieben wird, d.h. wie in langur skanki („langes Bein”), obwohl in der Aussprache offensichtlich bei den meisten Isländern ein Diphthong vorkommt, was man lángur skánki schreiben würde. Halldór Laxness schrieb nun Vokale vor ng und nk im Gegensatz zur offiziellen Rechtschreibung und dem Altisländischen, aber in Übereinstimmung mit der Aussprache, mit Akut bzw. als Diphthong: hríngur, hánki, úngur statt hringur, hanki, ungur, dreingur statt drengur, laungum statt löngum; aungull statt öngull.
Laxness sagte in einem Aufsatz aus dem Jahre 1941, der später in der Aufsatzsammlung Vettvángur dagsins („Der Schauplatz des Tages”) erschien, dass er der verbesserten Orthographie des dänischen Sprachwissenschaftlers Rasmus Rask folge, u.a. indem er Vokale vor ng mit Akut schreibe. Dort sagte er auch, dass er eine Zeit lang aufgehört habe, y zu schreiben (was im Neuisländischen genauso ausgesprochen wird wie i), dass er sich aber der offiziellen Orthographie „aus geschäftlichen Gründen” habe beugen müssen, was darauf Bezug nimmt, dass kein Verleger seine Bücher mit y-losen Worten herausgeben und z.B. firir und ifir statt fyrir und yfir schreiben wollte. Das scheint ein Zeichen dafür zu sein, dass sich die offizielle Rechtschreibung um 1940 schon ziemlich gefestigt hatte.
In Laxness’ Texten kann man darüber hinaus viele Beispiele für kleinere Funktionswörter finden, die nicht gemäß den Rechtschreiberegeln geschrieben werden. Diese Worte sollen als zwei oder mehr Worte geschrieben werden, Laxness aber schreibt sie zusammen, wodurch die Schreibung der gesprochenen Sprache gleicht: uppí, útúr, einsog, afhverju, útámeðal, þángaðtil, þaðanafsíður. Die eigensinnige Natur von Halldór Laxness in Bezug auf die Orthogaphie findet ihren Widerhall darin, dass er Anweisungen für seinen Korrekturleser schreiben musste, bevor dieser Texte für ihn gegenlas. Laxness sagte, er selbst glaube, dass die Orthographie einen Mittelweg gehen sollte zwischen der Orientierung an der Etymologie und an der Aussprache: ”Ich tendiere zu einer zweckdienlichen Orthographie, die in erster Linie von der Aussprache der lebendigen Sprache bestimmt wird, so wie man meint, dass sie am schönsten gesprochen wird, die aber auch die Etymologie und die Tradition berücksichtigt…” (Vettvángur dagsins 1986: 185.)